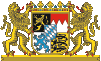Einst waren sie aus der Allgäuer Alplandschaft nicht wegzudenken, heute sind sie in den Bergen eine Seltenheit: Pferde. Während Namen wie Roßberg oder Roßgund noch von Zeiten zeugen, in denen Pferde als Arbeitstiere und Transportmittel unverzichtbar waren und selbstverständlich auch geälpt wurden, nehmen heute nur noch wenige Allgäuer Alpen Pferde auf.
Im Jahr 2020 wurden auf bayerischen Alpen und Almen insgesamt 900 Pferde aufgetrieben, rund die Hälfte davon im Allgäu. Rinder sind es dagegen bayernweit 54 000. Dabei bringen die Unpaarhufer durchaus Vorteile mit sich, wie bei einem Vortrag im Rahmen der Hirtenschulung des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu (AVA) deutlich wurde.
Stephan Kulms, am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten für die Pferdehaltung in ganz Schwaben zuständig, und Jennifer Brandl von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) referierten im April 2025 über die Vorteile und die Herausforderungen, die mit der Älpung von Pferden einhergehen.
Fachliche Hinweise und persönliche Anekdoten
„Ein Pferd ist keine Kuh“, fasste Brandl ihre Erfahrungen zusammen. Sie selbst ist seit 2014 als Hirtin in der Wildschönau in Tirol tätig, wo neben Milchkühen, Jungvieh, Ziegen und Schweinen auch rund zehn Pferde geälpt werden. Ihre Tipps und Hinweise veranschaulichte sie mit persönlichen Anekdoten aus dieser Arbeit. Sie betonte, dass es wichtig sei, der Haltung von Pferden sachkundige Hirten zu haben, weil Pferde als Fluchttiere ein anderes Verhalten an den Tag legten als Rinder. Zudem seien sie für andere Krankheiten und Parasiten anfällig und reagierten stärker auf Giftpflanzen wie Jakobskreuzkraut oder die Samen des Bergahorn.
Karge Nahrung für die Steppentiere
In der Futterversorgung seien Pferde auf der Alpe dagegen unkompliziert, wie Kulms darlegte. Die Steppentiere kommen mit karger Nahrung gut zurecht. Neben dem, was sie auf den Alpflächen finden – gerne fressen sie auch Weidereste und zum Beispiel Bürstengras vom Vorjahr –, etwas Salz und unter Umständen etwas Mineralfutter bräuchten sie über den Sommer kein weiteres Futter. Dass Pferde andere Pflanzen fressen als Rinder und damit gut zum „Nachputzen“ genutzt werden können, sei aber nur ein Vorteil unter mehreren, so Kulms: „Sie sorgen auch für eine natürliche Düngung, zertreten und fressen unerwünschte Sträucher und können so Flächen für andere Tierarten vorbereiten.“ Vor allem profitierten jedoch die Pferde selbst von einem Alpsommer. Das Leben in der Herde fördere die Sozialkompetenz gerade von Jungpferden, die naturnahe Robusthaltung und die Bewegungsfreiheit stärkten Abwehrkräfte, Muskulatur und Gelenke.
Vor dem Auftrieb alle Tiere entwurmen
Wichtig, so die Experten, seien vor allem oberhalb der Baumgrenze ausreichend Unterstände, in denen alle Herdenmitglieder Schutz vor Sonne, Insekten oder Hagel finden könnten. Zugang zu einwandfreiem Wasser sei essentiell für das Wohl der Tiere und um Parasitenbefall zu vermeiden. Vor dem Auftrieb müssten alle Pferde entwurmt werden, betonte Brandl. Zudem müssten mindestens drei Wochen vor dem Auftrieb die Hufeisen abgenommen werden. Beim Auf- und Abtrieb sei zu beachten, dass die Herde möglichst gemeinsam bewegt wird und genügend Helfer zur Verfügung stehen, um unerfahrene oder schwierige Pferde am Halfter zu führen.
Besondere rechtliche Rahmenbedingungen
Kulms betonte, dass für die Pferdehaltung auch andere rechtliche Rahmenbedingungen gelten als für Rinder. Aus Tierschutz-Sicht empfahl er eine Orientierung an den Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die Kontroll- und Aufsichtspflicht sei bei Pferden wie auch bei anderen Tieren auf der Alpe ein Thema, besonders in Regionen mit viel Wander- und Mountainbike-Tourismus. Beim Thema Wolf sah Kulms bisher wenig Grund zur Sorge. Von den bisher bekannten Wolfsrissen in Deutschland beträfen nur 1,2 Prozent Pferde, vor allem Fohlen, Ponys und alte Pferde. Dennoch sei die Gefahr von heftigen Fluchtreaktionen und Abstürzen für Pferde groß. Er empfahl daher zentral gelegene Nachtkoppeln, die besser bewacht werden könnten und auf denen gegebenenfalls sogar ein Schutzhund zum Einsatz kommen könne.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden